Heute schon das Morgen denken
Internationale Bauausstellungen und ihre Herausforderungen
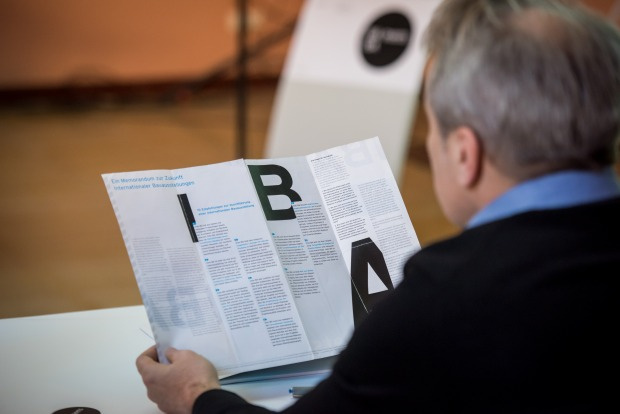 1 Bild vergrößern
1 Bild vergrößern
Wie ergeht es Ihnen, wenn Sie erzählen, dass Sie in Thüringen leben? Kennen Sie ihn auch, den manchmal etwas neidvoll angehauchten Blick Ihres Gegenübers, ob der hohen Lebensqualität, die der Freistaat mit seinen reizvollen Kulturlandschaften und reichhaltigem kulturellen Erbe bietet? Der Blick von außen auf Thüringen ist vielfach positiv besetzt. Wozu dann eine Internationale Bauausstellung (IBA) wagen? Wo liegt der „Ausgangsschmerz“, so wurde insbesondere auch von externen Experten in den anfänglichen Diskussionen kritisch hinterfragt, der einen Ausnahmezustand auf Zeit rechtfertige?
Die Architektenkammer Thüringen gehörte zu den Initiatoren der Internationalen Bauausstellung. Ihr gelang es 2009, die IBA im Koalitionsvertrag der damaligen Landesregierung zu verankern. Was war ihre Motivation? Es gehört zum Selbstverständnis der Kammer, sich nicht nur für die Sicherung der Rahmenbedingungen der Berufsausübung ihrer Mitglieder einzusetzen, sondern sich auch der baukulturellen Entwicklung des Landes, in dem sie verortet ist, verbunden zu fühlen. Hierbei zielt das baukulturelle Engagement sowohl auf die Entwicklung von regionalen, städtebaulichen, architektonischen und landschaftsarchitektonischen Qualitäten als auch auf die Analyse ihrer Entstehungsbedingungen sowie auf Prozesse und Instrumente der Qualitätsentwicklung und Innovationsförderung.
Die Herausforderungen des demografischen und wirtschaftlichen Strukturwandels, denen sich der Freistaat Thüringen zu stellen hat, liegen auf der Hand. Doch wie spiegeln sich ihre Lösungsansätze räumlich wider? Noch halten sich die „Wundmale“ eines sich abzeichnenden Strukturwandels in Grenzen. Der Druck auf die Verwertung von Kulturlandschaften, die Konkurrenz zwischen „Teller und Tank“, jedoch steigt. Wie werden sich die Landschaftsbilder zukünftig ändern? Werden wir den Wandel bewusst gestalten? Die erste Phase des Stadtumbaus wurde gemeistert und Leerstände im Wohnungsbau beseitigt. Doch eine zweite Leerstandswelle droht, die aufgrund ihrer Komplexität, was Standorte, Eigentümer-, Bau- und Nutzungsstrukturen betrifft, insbesondere modifizierte Strategien für den ländlichen Raum erfordert.
In einigen Regionen lassen „Witwenstraßen“ erste Symptome des demografischen Wandels sichtbar werden. Leerstandsmanagement wird zur komplexen Aufgabe der Stadt- und Regionalentwicklung. Was sind die städtebaulichen Leitbilder eines „Landumbaus“? Ist ein Paradigmenwechsel in der Planung gefragt? Was bedeutet Schrumpfung für die Infrastrukturentwicklung?
Die Ressource Thüringens, sein charakteristisches Siedlungsnetz an Klein- und Mittelstädten, als „StadtLand Thüringen“ bereits in Publikationen beschrieben, ist bei allen Wandlungsprozessen Chance und Risiko zugleich. Verdichtung allein ist keine Qualität an sich. Welche Lebensentwürfe lassen sich in einer neu formulierten Stadt-Land-Beziehung abbilden? Bietet das Prinzip einer vernetzten, dezentralen Konzentration ein neues regionalplanerisches Leitbild und durchaus lebenswerte und tragfähige Alternativen zu den Vorteilen metropolitaner Verdichtungsräume?
Anlass genug, so der Anspruch der Architektenkammer Thüringen, mit Kreativität und Innovationskraft räumliche Lösungsmuster auf diese Fragen zu suchen und heute schon das Morgen zu denken.
2015 – gut fünf Jahre nach der Initialzündung – befindet sich die IBA Thüringen auf dem Weg, ihr eigenes Profil aus der Komplexität der Herausforderungen und Ansprüche herauszuarbeiten. Es ist eine Besonderheit, dass zeitgleich drei weitere Internationale Bauausstellungen stattfinden. Die IBA Basel hat sich die Entwicklung der trinationalen Stadtregion zum Ziel gesetzt. Ihr Leitsatz lautet: Gemeinsam über Grenzen wachsen. Jedes Projekt soll die grenzüberschreitende Kultur des Zusammenwachsens und Zusammenlebens konkretisieren. Die IBA Heidelberg trägt das Motto „Wissen schafft Stadt“. Bis 2022 wird am Ideal einer Wissensstadt der Zukunft gebaut. Die IBA Parkstad (Limburg) ist die erste nicht-deutsche IBA. Aufhänger in der Parkstad ist der demografische Wandel in der Region. Es geht um Stärkung der regionalen Struktur und Profilierung der gesamten Grenzregion.
Der breite Zuspruch, den das Instrument der Internationalen Bauausstellung gerade in jüngster Vergangenheit erfährt, zeigt, dass es sich zu einem Markenzeichen der Planungskultur entwickelt hat. Ein Blick auf die vergangenen IBAs macht ihre Wandlung von der Architekturausstellung zur Baukulturausstellung deutlich. Zunehmend rückt der Transformationsprozess von Regionen in den Fokus.
Droht eine inflationäre Anwendung des Instruments? Ist der Anspruch an Qualität noch zu gewährleisten? Das Netzwerk „IBA meets IBA“, dem auch die IBA Thüringen angehört, will dem begegnen. Im Rahmen eines regelmäßigen Erfahrungsaustausches der ehemaligen und aktuellen IBAs werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der thematischen Ausrichtung, ihre internationale Relevanz, diskutiert, die Tragfähigkeit von Alleinstellungsmerkmalen reflektiert sowie Mindestvoraussetzungen eines organisatorischen Rahmens erörtert.
Im Memorandum zur Zukunft Internationaler Bauausstellungen gab das Netzwerk bereits 2009 zehn Empfehlungen zur Durchführung einer IBA. Es ist eine Selbstverpflichtung zur Qualität verbunden mit dem Anspruch, auch das Format weiterzuentwickeln. Hierbei ist die Balance zwischen lokalem Anlass und internationaler Relevanz, zwischen Projektqualitäten und Prozessorientierung, kuratorischer Setzung und Motivation zum Mitmachen, zwischen Provokation und Konsens, linearem und iterativ-reflexivem Vorgehen immer wieder neu zu definieren.
Auch die IBA Thüringen muss sich diesen Zerreißproben stellen. Es handelt sich hierbei um einen Prozess, bei dem sich der programmatische Ansatz zunehmend verdichtet und an Kontur gewinnt. In der Mai-Ausgabe des Deutschen Architektenblatts werden wir mit Dr. Marta Doehler-Behzadi, Geschäftsführerin der IBA Thüringen GmbH, über ihr Selbstverständnis, das Alleinstellungsmerkmal der IBA Thüringen und die Herausforderungen, die mit einem frühen Projektaufruf verbunden sind, sprechen. Wir werden den Fragen nachgehen: Welche Methoden befördern Innovation? Welche Rolle kommt in dem Zusammenhang dem Anspruch an Internationalität zu? Und: Erzeugt das Element der Provokation Widerspruch und regt Debatten an, für die IBA von Belang ist?
Die erste IBA-Ausstellung STADTLAND, die vom 29. Mai bis 17. September 2015 in der Viehauktionshalle Weimar präsentiert wird, wird eine andere Sichtweise auf Landschaft und Städtebau, Stadt und Dorf sowie deren lokale Entwicklungen und globale Abhängigkeiten zeigen. Wir sind gespannt, welche neuen Lesarten sich ergeben und welche räumlichen Impulse sich daraus ableiten lassen.
gp
(Anm. d. Red.: Infolge des tragischen Brandes in der Weimarer Viehauktionshalle in der Nacht vom 21. auf den 22. April 2015 wurde die Ausstellung abgesagt.)
IBA-Memorandum*
*Quelle: Durth, Werner u.a. (2009): Ein Memorandum zur Zukunft der internationalen Bauausstellungen
01 Jede IBA hat aus lokalen und regionalen Problemlagen jeweils drängende Aufgaben auf Bereiche der Architektur und Stadtplanung zentriert. Eine IBA zeichnet aus, dass sie Zukunftsfragen gesellschaftlichen Wandels auf solche Aspekte fokussiert, die räumliche Entwicklungen anstoßen und durch Gestaltung von Räumen beeinflusst werden können.
02 Eine IBA ist mehr als eine Architekturausstellung. Sie stellt gesellschaftliche Entwürfe zur Diskussion und gibt Antworten auf soziale Probleme nicht nur in der Gestaltung von Gebäuden, sondern auch in neuen Formen der Aneignung städtischer Räume und macht diese sichtbar. Im Erleben einprägsamer Orte sind die Botschaften einer IBA präsent.
03 Eine IBA entsteht aus konkreten Herausforderungen der Stadtgesellschaft, aus jeweils aktuellem Problemdruck: Zentrale Themen einer IBA müssen aus Anlass und Ort herausgearbeitet werden. Jede IBA hatte ihre Vorgeschichte durch lokal oder regional begrenzte Initiativen und Ereignisse, die als Impulse für weitergehende Programme wirkten. Zur Definition der Themen sind vorbereitende Diskurse und vorgeschaltete Werkstätten wichtig.
04 Eine IBA folgt dem Anspruch, modellhafte Lösungen für aktuelle Probleme in baukultureller, ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht zu entwickeln. Durch ihren programmatischen Anspruch gelingt es, diese im internationalen Maßstab aufzuzeigen, zur Diskussion zu stellen und dadurch nachhaltig Fragen des Städtebaus und der gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt anzuregen.
05 Jede IBA lebt zunächst von ihren gebauten Ergebnissen. Mit einer IBA wird die Aufmerksamkeit jedoch nicht allein auf das Gebaute, sondern auch auf die Wahrnehmung der Entstehungsbedingungen und der Qualität von Prozessen gelenkt. Jede IBA steht dafür, über die Qualifizierung von Verfahren zu einer neuen Planungs- und Baukultur zu gelangen, die als Zusammenspiel von Prozess- und Ergebnisqualität erkennbar wird.
06 Eine IBA muss von Anbeginn in der internationalen Dimension angelegt sein. International wird eine Bauausstellung durch herausragende Beiträge aus dem Ausland, durch die in den Projekten angelegte internationale Relevanz und durch eine international ausgerichtete Öffentlichkeitsarbeit.
07 Eine IBA wird durch Konzentration der intellektuellen, künstlerischen und finanziellen Kräfte auf einen überschaubaren Zeitraum möglich, als ein Ausnahmezustand auf Zeit. Sie ist ein Entwicklungslabor, in dem durch intensive Kooperation zwischen Experten und Betroffenen sowie durch deren Erfahrungen und Erfolge Projekte andernorts ermutigt werden können.
08 Eine IBA verlangt Mut zum Risiko. Sie ist ein Experiment mit offenem Ausgang und generiert neue Ideen unter anderem durch Provokation, die auch Widerspruch erzeugen kann. Kontroversen sind ein wesentliches Element der Planungskultur. Dies muss allen Akteuren, Verbündeten und vor allem der Öffentlichkeit von Anbeginn bewusst gemacht werden, um Freiräume jenseits der Alltagspraxis eröffnen und ein breites Interesse an den Projekten wecken zu können.
09 Jede IBA braucht angemessene Organisationsformen, um zu exemplarischen und generalisierbaren Lösungen mit hoher Ausstrahlungskraft zu kommen. Nicht die bereits etablierten Verfahren und bewährten Handlungsmuster sind gefragt, sondern Phantasie in Programm, Gestaltung und Organisation sowie die Kunst der Improvisation und schnellen Reaktion auf Unvorhersehbares.
10 Jede IBA lebt von ihrer Verbreitung. Zeitgemäße Strategien der Präsentation und der Kommunikation sind Voraussetzungen ihres Erfolgs. Eine IBA ist darauf angewiesen, die jeweils neuesten, wirksamsten Kommunikationsformen, -formate und -wege zu nutzen und weiter zu entwickeln.